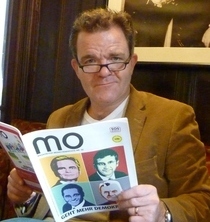Abschotten funktioniert nicht
Wie ethnische Solidarität hilft, wenn die Mehrheitsgesellschaft auslässt, erzählen Murat Batur und Rusen Timur Aksak am Beispiel der türkischen Community in Österreich.
Interview: Baruch Wolski Bilder: Karin Wasner
 In der türkischen Community in Österreich sind auffallend viele Hilfsvereine aktiv. Welche Aufgaben übernehmen diese Vereine?
In der türkischen Community in Österreich sind auffallend viele Hilfsvereine aktiv. Welche Aufgaben übernehmen diese Vereine?
Aksak: Der Verein, in dem ich mich engagiere, unterstützt insbesondere türkeistämmige junge Menschen, die zum Studieren hierher kommen. Sie haben natürlich spezifische Sorgen und Nöte. Das fängt bei der Sprachbarriere an und führt bis zu Fragen konkreter Abläufe des Studiums. Dabei gibt es ein massives Problem mit ominösen Beratungsfirmen, die die Studenten um 4-5000 Euro hier herbringen und dann ganz normal anmelden. Die Leute werden also für einen ganz einfachen Prozess abgezockt. Diese Problematik ist leider relativ unbekannt. Mich erinnert das an meine Eltern, die als Gastarbeiter ins Land gekommen sind und vergleichbare Schwierigkeiten erlebten.
Batur: Dass man eine Selbstorganisation gründet, ist der erste Schritt zu einer Solidarität und schlicht dazu gedacht, um anderen zu helfen. Da geht es um keinen Selbstzweck, sondern darum, sich als Community zu organisieren und sich im täglichen Leben wie auch in Notfällen gegenseitig zu helfen.
Wie wichtig ist migrantische Selbstorganisation? Und wie funktioniert sie?
Batur: Die stärkste Form der Solidarität ist innerfamiliär, so wie in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft auch. Danach kommen die landsmannschaftlichen Solidaritäten, die sich aufgrund regionaler Gemeinsamkeiten bilden. Dann folgen religiöse und politische Netzwerke. Dabei geht es zumeist um finanzielle Unterstützung, um Ressourcen- und Wissenstransfer, aber etwa auch um die Organisation von Beerdigungen oder Hochzeiten. Zuallererst kommt die Binnenintegration. Das heißt, wenn Migranten in ein neues Land kommen, werden sie zuerst in ihre jeweilige ethnische Community integriert. Das heißt, sie werden zuerst von den Vereinen aufgenommen, in denen es für sie keine Sprachbarriere gibt. Dort wird ihnen geholfen, indem ihnen die bürokratischen Wege erklärt werden, klassischer Informationstransfer also. Wo findet sich Arbeit, wo Unterkunft?
Basieren die Angebote der Community auf ehrenamtlicher Arbeit?
Batur: Ja, ich schätze zu etwa 90 Prozent.
Es wird immer wieder beklagt, dass nur wenige Migranten in den großen ehrenamtlichen Betätigungsfeldern der Österreicher zu finden sind: Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz etc. Die ehrenamtliche Arbeit, die Migranten leisten, wird kaum bis gar nicht wahrgenommen.
Batur: Die reicht von Nachhilfe für Kinder bis zum Engagement für alte Menschen. Aber die Vereine kommunizieren das auch selbst nicht nach außen. Die migrantischen Organisationen müssten wohl mehr Medienarbeit leisten.
Aksak: Das ist sehr wichtig. Wir dürfen nicht nur immer davon reden, was die Anderen falsch machen, wir müssen auch ganz stark unsere Eigenverantwortung betonen. Wenn man die vielen positiven Sachen nicht einmal ansatzweise nach außen kommunizieren kann, dann haben wir offensichtlich ein Problem.
Welche Motive gibt es, sich zu engagieren? Oft ist von fehlender Solidarität in der Gesellschaft die Rede.
Batur: Ich denke, die Ankunftsgesellschaft ist strukturell nicht gerüstet für die Immigranten. Deshalb übernehmen die Familien diese Funktionen. Wenn aber ein Immigrant ohne Familie herkommt, dann leistet das die ethnische Gemeinschaft, soweit sie eben organisiert ist. Die Gesellschaft hat noch nichts entwickelt, um Migranten in ihrer ersten Zeit zu unterstützen.
Aksak: Zu erwähnen ist auch, dass der Druck der Mehrheitsgesellschaft ethnische Communities zusammenschweißt. Das heißt, ich fühle mich deshalb mit jemandem aus Ostanatolien verbunden, obwohl ich aus dem Westen, aus Istanbul, stamme. Man kann sich mit den Problemen der Anderen sehr gut identifizieren, kennt das Gefühl von Fremdheit selbst. Und auch die Anfeindungen. Ein Beispiel: Die Vize-Vorsitzende unseres Vereins trägt Kopftuch. Pöbeleien, die sie mittlerweile als normal betrachtet, sind für mich eigentlich schon strafrechtlich relevant.
Aber warum wird nur entlang ethnischer Grenzen geholfen?
Aksak: Ich werde sicher niemanden ablehnen, weil er nicht aus der Türkei stammt. Aber wenn die Leute noch ein gemeinsames kulturelles Erbe mit mir teilen, dann ist der Zugang für sie und für mich einfacher. Ich frage mich, ob der Begriff „innerethnische Solidarität“ überhaupt stimmt. Bei meinem Verein z.B. ist es so, dass kurdischen Kollegen da ebenso eine wichtige Rolle spielen. Ich würd das nicht ethnische Solidarität nennen sondern eher herkunftsbezogene Solidarität.
Batur: Der Begriff Ethnie wird mittlerweile sehr undifferenziert verwendet. Er wird auf religiöse Gruppen, auf sprachliche Gruppen und auf kulturelle Gruppen angewandt. Und das alles wird zusammengefasst unter dem Begriff Ethnizität. Das sollte differenziert werden. Beispielsweise organisieren sich muslimische Migranten nicht entlang von Ethnie sondern aufgrund der Sprache. Es gibt albanische, bosnische, türkische, arabische Moscheen. Aber das bedeutet nicht, dass die Leute aus diesen Ethnien stammen sondern in erster Linie, dass sie diese Sprachen beherrschen. Also dass der Hodscha beispielsweise Bosnisch spricht und auch in dieser Sprache die Freitagspredigt hält.
Sind diese ethnischen Strukturen nicht so zählebig, dass sie selbst dann überleben, wenn ihre Funktion obsolet geworden sind?
Aksak: Wenn die Strukturen mal da sind, dann gibt es eine Eigendynamik. Die türkischen Moscheenvereine wird es viel länger geben, als es türkische Arbeitsmigranten gibt.
Batur: Es gibt auch das Phänomen, dass Leute ihre ethnischen Wurzeln wiederentdecken. Etwa bei italienischen Einwanderern in den USA, obwohl die Gesellschaft viel offener ist als in Europa, was kulturelle Eigenarten anbelangt. Da findet dann sozusagen eine Wiedererfindung der italienischen Identität statt. Von Funktionalität kann hier gar nicht mehr direkt die Rede sein.
Wird sich innerethnische Solidarität mit der Zeit aufweichen und einem gesamtgesellschaftlichen Engagement weichen?
Batur: Die dritte Migrationswelle aus der Türkei aus den 90er Jahren ist durch eine Gesetzesnovelle zur Familienzusammenführung geprägt. Da haben die Leute versucht, vor allem in den Großfamilien aus der Türkei zu heiraten. Da sind sozusagen Ehepartner nach Österreich importiert worden. Das wird aber weniger, mittlerweile heiratet die 3. und 4. Generation untereinander. Es ist schon ein ausreichender Heiratsmarkt entstanden, der es verhindert, dass man die Verbindungen zur Türkei noch so stark hat. Man heiratet auch innerhalb des EU-Raums, man sucht also auch Partner in Deutschland, Frankreich etc. Das könnte in weiterer Folge dazu führen, dass sich die ethnische Solidarität langsam auflöst. Aber das würde noch mindestens eine Generation benötigen.
Wäre das eine wünschenswerte Entwicklung?
Aksak: Von mir aus kann die ethnische Solidarität gerne abnehmen, wenn das Sozialsein erhalten bliebe und sich unabhängig vom religiösen bzw. kulturellen Background ausdrückt. Ich finde es aber auch schön, wenn es sie weiterhin gibt und sie ergänzt wird durch Engagement für die gesamte Gesellschaft.
Laut dem Wiener Sozialforscher Reiterer macht postmoderne Ethnizität aus, dass die individuelle Nützlichkeit ausschlaggebend ist und nicht das transzendente Kollektive. Das heißt, es ist funktional und ist es nicht mehr funktional, wird es entsorgt oder auf belanglose Folklore herunter gebrochen.
Batur: Stellt sich die Frage, für wen diese Postmoderne überhaupt zugänglich ist. Die europäische Mehrheitsgesellschaft hat so einen Zugang zu Identität. Sie hat zu allen kulturellen Phänomenen einen ähnlichen Zugang. Das ist fast konsumorientiert. Diese Identität ist eine Zeit lang brauchbar, die ist hipp, die ist gut, wenn sie nicht mehr Mode ist, nicht mehr funktional, dann lasse ich das. Ich kann auch verschiedene Identitätsfragmente zu einer Patchwork-Identität zusammenbasteln. Oder mir eine Patchwork-Religion zimmern. Die migrantischen Identitäten sind weniger beliebig und erwachsen stärker aus Notwendigkeiten. Migranten müssen sich damit auseinandersetzen, dass sie eine Herkunftskultur haben und eine Kultur in der sie leben und sie müssen daraus etwas machen. Sie sind nicht so frei. Es gibt einen Druck von der Mehrheitsgesellschaft, es gibt einen Druck von der Herkunft und daraus muss etwas geschaffen werden, das dann hybride Züge annimmt. Da ist keine Mittelschichtsbeliebigkeit, dass man etwas nimmt, weil es einem Spaß macht, sondern da handelt es sich um Notwendigkeiten, mit denen man konfrontiert ist. Und das kann dann auch in die Gegenseite umschlagen, dass man immer mehr die kulturelle Herkunft betont und sich eine geschlossener Identität zulegt. In der Türkei selbst sieht das anders aus, also in der Herkunftsgesellschaft. Da haben wir diese Patchwork-Identitäten. Wo sich links und rechts und Religion einfach vermischen kann, ideologisch gesehen. In der Migrantengemeinschaft hier in Europa findet sich das eher nicht. Zygmunt Baumann sagt, die Postmoderne ist kein Begriff, der für alle gleich gilt. Ein Beispiel, um es zu verdeutlichen: Es gibt Touristen und Nomaden. Touristen fahren aus Lust und Laune von einem Ort zum Anderen aber auch von einer Identität zur Anderen. Für Nomaden ist es eine aufgezwungene Realität. Sie gehen nicht von einer Identitätsformation zur anderen, weil es Ihnen Spaß macht, sondern weil die Ankunftsgesellschaften so viel Druck machen.
Aksak: In der Mehrheitsgesellschaft haben die Menschen den Luxus, dass sie freier über ihre Identitätskonstruktionen entscheiden können. Ob da Formen der Beliebigkeit eintreten, darüber kann man sich streiten, aber es gibt durchaus Beispiele, die für so etwas sprechen. Etwa eine Partei, die in einer antiklerikalen Tradition steht und neuerdings mit dem Katholizismus kokettiert. Bei mir zum Beispiel, könnte ich mich, selbst wenn ich wollte, nie von der muslimischen Identität lösen. Es geht nicht, weil der Namen muslimisch ist, weil die Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft dementsprechend ist. Ich bin erst zum Tiroler geworden, als ich Tirol verlassen habe. Aufgrund meines auffällig tirolerischen Akzents.
Was sind die Kosten der traditionalen ethnischen Identität?
Batur: Es gibt auch die Schattenseite, den innerethnischen Druck. Den kann man nicht wegdiskutieren. Das ist ein Handel, den jeder Einzelne eingeht. Ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die mit einem Problem konfrontiert war, das sie auf traditionelle Art löste. Sie sagte, sie lasse sich deshalb auf die traditionellen Wege ein, wie ein solches Problem zu lösen ist, damit sie nachher auf die Solidarität zählen kann. Das ist die Rechnung, die dahinter steht. Zu den Kosten gehört ganz praktisch, dass du bestimmten Konventionen unterworfen bist, die in dieser Community gelten, wie man sich gegenüber Älteren verhält, wie man sich zwischen den Geschlechtern verhält etc. Du darfst dies nicht reden, du darfst jenes nicht machen, aber dafür hast du dann, wenn dir irgendwas passiert, die Unterstützung der Community, weil sie dich nicht ausgeschlossen hat. Weil du dich ihren Regeln unterworfen hast. Nun kommt es darauf an, wie die Menschen subjektiv diesen Druck verspüren. Für einen außenstehenden mitteleuropäischen Menschen hört sich das manchmal schlimm an. Aber für jemanden, der aus der türkischen Community kommt, wird das nicht unbedingt ebenso empfunden. Das reicht bis zu den Traditionalitäten in religiösen Fragen.
Aksak: Mehr Sicherheit und weniger Freiheit. Vielleicht können so die Kosten der innerethnischen, innerkulturellen bzw. innerreligiösen Solidarität zusammengefasst werden.
Die politische Rechte erhebt den Vorwurf, dass insbesondere Türkinnen und Türken eine Parallelgesellschaft bilden.
Aksak: Sich abzuschotten funktioniert nicht. Wenn du beruflich erfolgreich sein willst, einen bestimmten Bildungsweg gehen willst, geht das gar nicht. Aber in manchen Momenten beneide ich diese Menschen, die sich abschotten können. Gerade in Wahlkampfzeiten ist das bestimmt angenehm. Grundsätzlich gibt es bei diesem Thema aber eine geradezu groteske Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft. Leute betrachten uns von außen als unglaublich homogen. Das hätte vielleicht Vor- und Nachteile, ist aber einfach nicht wahr. Im Fall der Türkei gibt es Linke, Rechte, Religiöse, Laizisten, Aleviten, Sunniten, klassische Arbeitsmigranten und Flüchtlinge nach einem Militärputsch. Diese Gemeinschaft ist extrem heterogen.
Batur: Und diese Heterogenität führt bis in die Organisationen selbst. Die meisten muslimischen Migranten hier sind beispielsweise religiös, religiöser auch als ihre Herkunftsgesellschaften. Sie werden das, weil sie hier in einer fremden Umgebung sind. Die Frage ist, wie sich Parteien, Gewerkschaften, staatliche Institutionen, Unis auf die Leute einstellen können. Ich halte die Mehrheitsgesellschaft in Österreich bislang nur für bedingt ‚aufnahmefähig’ für die Leute. Das führt dazu, dass, obwohl sich die innerethnischen Begrenzungen langsam auflösen, die meisten Migranten weiterhin in ethnischen Organisationen zuhause sind. Kein Wunder: Wenn man dauernd gegen Wände stößt, gibt man es irgendwann auf. So gesehen üben die ethnischen Communities nach wie vor eine Schutzfunktion aus: Nunmehr auf der Ebene, dass man sich hier sozial oder anders engagieren kann, ohne die Hürden der Mehrheitsgesellschaft in Kauf nehmen zu müssen.
Was versteht ihr unter Integration? Was wäre ein Zustand, wo man sagen kann, das passt jetzt?
Aksak: ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich lege auch keinen Wert darauf als integriert zu gelten. Das soll keine Arroganz sein, ich habe einfach nie einen Sinn dafür gesehen. Wenn mir Freunde in einer Anwandlung dann und wann mal sagen, du bist so gut integriert, dann ist es eigentlich schon eine Beleidigung. Das hebt nämlich die prinzipielle Gleichberechtigung zwischen uns wieder auf. Weil das ja beinhaltet, sie können über mich urteilen, ob ich integriert bin oder nicht. Da stellt sich die Frage, über die man in Österreich interessanterweise fast nie redet: Sind wir gleichberechtigt? Klar, wenn man erfolgreich sein will in dem Land, dann muss man Deutsch können. Dann muss man sich auch der Mehrheitsgesellschaft öffnen. Dazu muss aber nicht die eigene Identität aufgegeben werden. Und der Migrationshintergrund darf sich dann auch nicht nachteilig auswirken.
Batur: Ich hab mit dem Integrationsbegriff deshalb ein Problem, weil daran so viel angehängt wird. Soziologisch können zwei Arten von Integration unterschieden werden: Die strukturelle Integration und die sozial-kulturelle Integration. Wenn man hier irgendwie leben will, muss man strukturell integriert sein. Man muss eine Wohnung haben, man braucht eine Arbeit, man ist den Gesetzen unterworfen. Strukturell ist der Migrant sehr schnell integriert. Beim anderen beginnt das Problem. Wenn es nur auf die Sprache beschränkt wäre, dann ok. Aber was in der öffentlichen Diskussion unter Integration verstanden wird, das ist ganz was Anderes. Da wird sehr viel an Kulturellem drangehängt, das eigentlich nicht notwendig wäre. Das geht hin bis zum Aussehen, das geht hin bis zu religiösen Angewohnheiten, die weniger ernst genommen werden müssten. Das Rundherum, das um diesen Begriff aufgebaut wurde, macht ihn sinnlos und nicht mehr funktional. Ein Angebot an die Migranten aktiv an dieser Gesellschaft teilzuhaben, das gibt der Begriff nicht mehr her.
Aksak: Was viele nicht sehen wollen, ist die Willkür in der Integrationsdebatte. Es können willkürlich Anforderungen gestellt werden. Um zum Beispiel der Kollegin mit Kopftuch zurückzukommen. Ob sie eines tragen will oder nicht, ist alleine ihre Sache. Die Freiheit muss uns zugestanden werden, nicht das ganze Profil anzunehmen. Wenn ich mir jetzt einen Fez aufsetzen würde, würde das meinen Integrationsstatus wohl nicht ändern, oder? Man sollte bei all diesen Debatten auch mal die Menschen sehen, ihre Bedürfnisse und ihre Freiheiten, anstatt sie dauernd nur verändern zu wollen. Das wird alles von außen extrem aufgeladen. Ich bin auch schon oft auf meinen Bart angesprochen worden, wobei ich den rein aus ästhetischen Gründen trage.
Wie sollten staatliche Institutionen mit der türkischen Community umgehen? Wie gehen sie mit ihr um?
Aksak: Stiefmütterlich. Ich komme aus Kufstein, der Heimatstadt des ÖVP-Generalsekretärs übrigens: mein Vater hat sich vor ein paar Jahren politisch engagiert und eine eigene Wahlliste für Migranten aufgestellt. Damals hatte ich einen ziemlich guten Einblick bekommen. Im Wahlkampf haben alle Parteien sehr wohl den Weg zu den Moscheenvereinen gefunden. Selbst die extreme Rechte. Aber immer inoffiziell. Keine Fotos, keine Aussendung, gar nichts. Da wird dann das gute Zusammenleben beschworen. Aber man weiß, dass das erstens alles inoffiziell ist und zweitens nachher sich keiner mehr daran erinnern wird.
Batur: In Frankreich oder Großbritannien zeigt sich, dass der Staat ethnische Selbstorganisationen zur Kenntnis nehmen und politische Ausdrucksmöglichkeiten schaffen kann.
 Wenn es landwirtschaftliche Verbände, Berufsorganisationen, etc. gibt, warum dann nicht auch für ethnische Organisationen? Aber der Staat wird so lange nichts ändern, solange es keinen Druck von unten aus den Communities gibt. Bis jetzt wird bloß Symbolpolitik betrieben.
Wenn es landwirtschaftliche Verbände, Berufsorganisationen, etc. gibt, warum dann nicht auch für ethnische Organisationen? Aber der Staat wird so lange nichts ändern, solange es keinen Druck von unten aus den Communities gibt. Bis jetzt wird bloß Symbolpolitik betrieben.Aksak: Was das Thema der Integration betrifft würde ich – im politischen Sinn – nicht sagen, dass türkeistämmige Migranten besonders schlecht integriert sind. Da gibt es große Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen. Bei den Grünen sind die Aleviten zum Beispiel sehr stark vertreten, während sunnitische türkische Leute dort fast gar nicht existieren. Bei den wenigen türkeistämmigen Journalisten im Land sind mindestens 80 Prozent alevitisch. Ich als türkischer Sunnit bin da quasi eine absolute Rarität.
Batur: Es ist naiv zu sagen, der Staat soll was machen. Aber wenn er was machen sollte, dann müsste er mit einem kulturell Anderen umgehen lernen. Aleviten und Kurden sind wahrscheinlich kulturell näher, als es ist die sunnitische Mehrheit der Türkeistämmigen ist. Die sind großteils säkular, verstehen Religion vornehmlich als kulturelle Angelegenheit. Sie haben ein ähnliches Verständnis wie autochthone Österreicher. Wie man mit jemandem umgeht, der anders tickt als man selbst, das müssten politische Institutionen erst mal lernen. Erst dann könnte es sich auch die Bevölkerung aneignen.
Wird die Community in absehbarer Zeit einen solchen Druck aufbauen?
Batur: Ich glaube schon. Wir haben langsam eine Generation, die Deutsch als Erstsprache hat. Irgendwann wird sie genug haben von der Sprachlosigkeit, in die sie gedrängt wird. Sie kann sich nirgends artikulieren, die Vorgängergeneration hat keine Plattformen dafür geschaffen. Aber sie spricht auch kein Türkisch mehr. Irgendwann wird das mal aufbrechen. Wie viel kulturelles Gepäck sie mitnehmen werden, das bleibt offen.
Aksak: Sprachlosigkeit ist ein schönes Sinnbild für die Situation. Ich kann mich genau damit identifizieren, was der Kollege gesagt hat. So würde ich auch die Verantwortung definieren, die man für die eigene Community hat. Wobei ich aber sehr gut Türkisch spreche (lacht).
Batur: Dass sich alles in einer Form von Assimilation auflöst, halte ich für unwahrscheinlich. Wir leben in einer Zeit, in der es ein starkes Bewusstsein für Identitäten gibt. Zudem gibt es viele Möglichkeiten in einer Gesellschaft auch anders zu leben. Es gibt ein Verständnis dafür, dass Gesellschaft an und für sich pluralistisch ist. Das wird Formen annehmen, für die wir vielleicht keine historischen Vorbilder haben.
Zu den Personen:
Rusen Timur Aksak ist Student der Politikwissenschaft, freier Publizist und Obmann des „Türkischen Studentenverein Österreich“. Murat Batur ist Dissertant der Soziologie, Mitherausgeber einer sozialwissenschaftlichen Querschnittsstudie zur austrotürkischen Gemeinschaft und islamischer Religionslehrer.