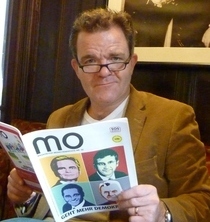Apparat mit Schwachstellen
Die Zeit nach Komani
In Salzburg wird eine Familie durch Abschiebung zerrissen. Die Landeshauptfrau erklärt zuerst ihre Unterstützung und sieht sich danach machtlos. Warum hat die Politik Angst vor humanitärem Bleiberecht? Text: Gunnar Landsgesell
 Wieder so ein Fall: ein achtjähriges Kind und dessen Mutter werden um sechs Uhr früh in Hallein aus dem Bett geholt und in ein Auto gesetzt. Der Mutter, Volksschullehrerin aus Armenien, wird das Handy abgenommen, um den Kontakt zu FreundInnen und Verwandten zu unterbinden. Der Ehemann und der 17jährige Sohn der Frau waren beim Zugriff der Fremdenpolizei nicht in der Wohnung. Dem achtjährigen Sohn wird laut Augenzeugen verwehrt, auf die Toilette zu gehen. Es bestehe Fluchtgefahr. Vom Bemühen um „familienfreundliche“ Abschiebungen, wie das Innenministerium betont, bleibt an diesem Tag nicht viel über. Auch nicht vom Paradigmenwechsel, den der Leiter der Fremdenpolizei Johann Bezdeka (siehe anschließendes Interview) in jüngster Zeit bemerkt haben will – oder auch erhofft. Seit dem Fall Komani sei einiges anders, man gehe „sensibler“ vor. Damals, im Oktober 2010, wurde ein Vater mit seinen siebenjährigen Zwillingstöchtern von sechs bewaffneten Uniformierten abgeführt. Die Kinder durften ihre Spielsachen nicht mitnehmen, Polizisten höhnten vor den Kindern über den Spitalsaufenthalt der Mutter. Anschließend wurden die Kinder in Schubhaft gebracht. Optisch hat sich seit damals doch etwas verändert. Kinder werden mit ihren Eltern nunmehr in „familiengerechten“ Anhaltezentren wie jenes, das jüngst in der Zinnergasse eröffnet wurde, verwahrt. Maximal 48 Stunden dauert der Zwischenstopp, dennoch handelt es sich um eine Anhaltung, die, wie Bezdeka betont, ein Fortschritt, aber dennoch nicht angenehm ist. Beamte treten den Betroffenen heute zumindest teilweise in zivil entgegen, auch Beamtinnen sollten vor Ort sein. Mit trotzigen Aussagen wie jenen der mittlerweile mit anderen Aufgaben befassten Ex-Innenministerin Fekter – „Ich gehe rechtsstaatlich und korrekt vor“ – geht deren Amtsnachfolgerin sparsamer um. Dass sich hier aber ein qualitativer Sprung abzeichnet, soll heißen, dass es heute zu weniger Abschiebungen von Familien kommt, glaubt Christoph Riedl nicht. Ein Bemühen um einen sensibleren Umgang seitens der Verantwortlichen im Innenministerium will der Geschäftsführer des Flüchtlingsdienstes der Diakonie dennoch erkennen.
Wieder so ein Fall: ein achtjähriges Kind und dessen Mutter werden um sechs Uhr früh in Hallein aus dem Bett geholt und in ein Auto gesetzt. Der Mutter, Volksschullehrerin aus Armenien, wird das Handy abgenommen, um den Kontakt zu FreundInnen und Verwandten zu unterbinden. Der Ehemann und der 17jährige Sohn der Frau waren beim Zugriff der Fremdenpolizei nicht in der Wohnung. Dem achtjährigen Sohn wird laut Augenzeugen verwehrt, auf die Toilette zu gehen. Es bestehe Fluchtgefahr. Vom Bemühen um „familienfreundliche“ Abschiebungen, wie das Innenministerium betont, bleibt an diesem Tag nicht viel über. Auch nicht vom Paradigmenwechsel, den der Leiter der Fremdenpolizei Johann Bezdeka (siehe anschließendes Interview) in jüngster Zeit bemerkt haben will – oder auch erhofft. Seit dem Fall Komani sei einiges anders, man gehe „sensibler“ vor. Damals, im Oktober 2010, wurde ein Vater mit seinen siebenjährigen Zwillingstöchtern von sechs bewaffneten Uniformierten abgeführt. Die Kinder durften ihre Spielsachen nicht mitnehmen, Polizisten höhnten vor den Kindern über den Spitalsaufenthalt der Mutter. Anschließend wurden die Kinder in Schubhaft gebracht. Optisch hat sich seit damals doch etwas verändert. Kinder werden mit ihren Eltern nunmehr in „familiengerechten“ Anhaltezentren wie jenes, das jüngst in der Zinnergasse eröffnet wurde, verwahrt. Maximal 48 Stunden dauert der Zwischenstopp, dennoch handelt es sich um eine Anhaltung, die, wie Bezdeka betont, ein Fortschritt, aber dennoch nicht angenehm ist. Beamte treten den Betroffenen heute zumindest teilweise in zivil entgegen, auch Beamtinnen sollten vor Ort sein. Mit trotzigen Aussagen wie jenen der mittlerweile mit anderen Aufgaben befassten Ex-Innenministerin Fekter – „Ich gehe rechtsstaatlich und korrekt vor“ – geht deren Amtsnachfolgerin sparsamer um. Dass sich hier aber ein qualitativer Sprung abzeichnet, soll heißen, dass es heute zu weniger Abschiebungen von Familien kommt, glaubt Christoph Riedl nicht. Ein Bemühen um einen sensibleren Umgang seitens der Verantwortlichen im Innenministerium will der Geschäftsführer des Flüchtlingsdienstes der Diakonie dennoch erkennen.
Offener Brief
Warum die Mutter und ihr achtjähriger Sohn aus dem Salzburger Hallein dennoch – zudem auf diese Weise – abgeschoben wurden, können viele Menschen nicht verstehen. Sechs Jahre lebte die Familie in Österreich, so lange wie die Komani-Zwillinge, deren Eltern zwei Wochen nach der dramatischen Abschiebung doch ein humanitäres Bleiberecht nachgereicht wurde. Auch die Salzburger Plattform Menschenrechte hatte in den Wochen davor an Landeshauptfrau Gabi Burgstaller appelliert, der „gut integrierten“ Familie, die 2011 den letzten negativen Bescheid erhielt, ein humanitäres Bleiberecht zu verleihen. Zwei Bürgermeister, mehrere Unternehmen als potenzielle Arbeitgeber sowie BürgerInnen schlossen sich dem an. Das Büro Burgstaller teilte der Plattform noch im Juli mit, man habe der Innenministerin geschrieben. Diese sollte einerseits den konkreten Fall prüfen, andererseits, wie sich Kinderrechte grundsätzlich auf das Aufenthaltsgesetz auswirken. Während die zweite Anfrage den Eindruck macht, es ginge hier rechtlich um Neuland, (tatsächlich können die Landeshauptleute als Niederlassungsbehörden erster Instanz die Kinderrechtskonvention als Grund heranziehen), war die erste offensichtlich völlig wirkungslos. In Salzburg hatte man sich mehr erwartet, vielleicht sogar einen kurzen Anruf nach dem Brief. Immerhin war es Burgstaller selbst, die das Engagement der Plattform Menschenrechte noch Monate zuvor mit dem Verdienstzeichen des Landes gewürdigt hatte. Und auch in einem anderen Fall, ebenfalls im Bezirk Hallein in Salzburg, hat sich der erwähnte Paradigmenwechsel nicht abgezeichnet. Im Mai dieses Jahres wurde Amina mit ihrer Mutter, beide kamen aus Gründen akuter Gefährdung aus Dagestan nach Österreich, wieder dorthin zurück gebracht.
Noch vor ihrer Abschiebung hatte Amina, eine HAK-Schülerin, ein START-Stipendium, das für engagierte SchülerInnen mit Migrationshintergrund vergeben wird, erhalten. Auch hier hatte das Bundesasylamt negativ beschieden. Und auch hier hatte Burgstaller zuvor ihre Hilfe zugesagt. Dass sie danach eben nur wenig Chancen gegen die Bürokratie einräumte, hält der Menschenrechtsaktivist Bernhard Jenny für zynisch. Als Mitglied der Menschenrechtsplattform hatte er die Ehrung abgelehnt und stattdessen Burgstaller einen offenen Brief geschrieben. Darin fordert er eine Bewusstseinsentwicklung hin zu mehr Gesamtverantwortung ein und löst sich auch vom Argument der „guten Integration“, das SympathisantInnen in letzter Hoffnung für die betroffenen Menschen gegenüber den Behörden ins Treffen führen. Jenny geht einen Schritt weiter, wenn er in Bezug auf eine ebenfalls abgeschobene Familie schreibt: „ weil der vater eine vorstrafe vor vielen jahren hatte, wurde er – obwohl längst abgesessen und verjährt – auch von anderen politisch verantwortlichen lieber nicht unterstützt und so zum zweiten mal durch unterlassene hilfeleistung bestraft. Was würden denn dann manche zeitungen schreiben!“ Die Landeshauptfrau antwortete darauf schriftlich: „Der Populismus soll und darf uns nicht daran hindern, uns aus ganzem Herzen für all jene einzusetzen, die – mehr noch als andere – auf die Einhaltung der Menschenrechte angewiesen sind.
Selten wird angesichts der ängstlichen Haltung vieler PolitikerInnen die Kluft zwischen Rede und Praxis so deutlich wie im Fall der rhetorisch wohlmeinenden Landeshauptfrau.
Bürokratie reloaded
In der bitteren Praxis wird letztlich gerne das Gesetz oder die Bürokratie bemüht. Auch die jüngsten Fälle in Salzburg scheinen dem Muster zu entsprechen, Verantwortung abzuschieben. RechtsberaterInnen können ein Lied davon singen, wie Bezirkshauptmannschaften, die MA 35 in Wien, die Fremdenpolizei und das Ministerium sich gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben, wenn es um fragwürdige Verfahren geht. Nun hat im Juni das Parlament eine große Verwaltungsreform beschlossen. Mikl-Leitner und ihr Regierungskollege Josef Ostermayer präsentierten auf einem überdimensionierten Taferl eine Formel, die qualitativ wenig aussagt, aber effizient klingt: „Aus 194 mach 1“. Das Asyl- und Fremdenwesen mit seinen jährlich 30.000 Verfahren soll nicht mehr an vielen Stellen quer durchs Land behandelt, sondern in einem neuen Bundesamt konzentriert werden. Peter Marhold, Rechtsberater der NGO „helping hands“, hält diese Ankündigung aber für falsch, denn, so Marhold: das Migrationsrecht sei auch weiterhin bei den Landesregierungen, Bezirkshauptmannschaften und Magistraten angesiedelt. Für Berufungen soll jedenfalls wieder das Bundesverwaltungsgericht zuständig sein. Der UBAS und, nach wenigen Jahren auch der Asylgerichtshof, sind dann bereits wieder Vergangenheit. Ob das neue Bundesamt strukturell eine Verbesserung bringt, ist unklar. Marhold kritisiert die beschlossene organisatorische Trennung in Bundesamt und Fremdenpolizei als reiner Vollzugsbehörde, die jetzt zumindest noch räumlich Zimmer an Zimmer am Hernalser Gürtel angesiedelt sind. Diese Struktur, so Marhold, sei schon mit der Teilung in Verfahrens- und Vollzugsreferate in der Fremdenpolizei vorweggenommen worden. Probleme ergeben sich daraus insofern, als im Bundesamt jemand die Bescheide erlässt, während jemand anderer sie vollzieht. Marhold: „In der Vergangenheit kannte der Beamte das ganze Verfahren, war mit dem Betroffenen direkt in Kontakt. Nun zerreißt man aber schon wieder das Caseownership eines Fremdenpolizisten. Der Vollzugsbeamte ist in Zukunft unbeleckt von der Frage, ob die Erlassung angemessen bzw. rechtlich haltbar ist.“
Ein anderes Problem sehen NGO-VertreterInnen in der Verquickung der Fragen von Asyl und humanitärem Bleiberecht. Christoph Riedel von der Diakonie sieht hier Grundrechtsfragen mit dem Zuwanderungsthema verbunden, die nicht an der gleichen Stelle zu klären sind. Darüber hinaus bezweifelt Riedl, dass die Reform eine Stärkung der Rechte der KlientInnen bringen wird, da in erster Instanz keine Rechtsberatung für AsylwerberInnen vorgesehen ist. Riedl hielte es für besser, die Vertretungspflicht (die RechtsberaterInnen verpflichtet, die KlientInnen zu vertreten, wenn diese es wünschen) im fremdenrechtlichen Verfahren zu belassen: „Damit hätte man eher die Gewähr, dass die Leute zu ihrem Recht kommen und nicht der Anschein entsteht, dass dieses Recht in der Gunst des zuständigen Referenten liegt.“ Die Machtposition, die die einzelnen FremdenpolizistInnen erhalten, würde verlangen, dass auch der Rechtsschutz ausgebaut und nicht eingeschränkt wird. Richtig wäre insofern gewesen, die Beratung in der ersten Instanz auch im Asylverfahren einzuführen, so wie man es bei der Fremdenpolizei im Dezember 2011 gemacht hat, und nicht stattdessen in beiden Verfahren wieder abzuschaffen. „Das“, so Riedl, „ist der falsche Weg.“ Nach der großen Reform ersparen sich jedenfalls die Landeshauptleute Unbilden wie im Fall von Burgstaller nach ihren „committments“. Dann sind sie frei gespielt von der lästigen Entscheidung, humanitäres Bleiberecht vergeben zu wollen, aber sich wegen der politischen Konkurrenz nicht zu trauen.